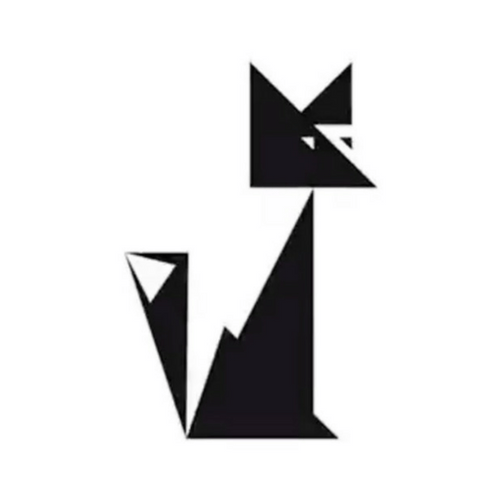Eine Depression kann in einer Beziehung zum sexuellen Ungleichgewicht führen. Denn depressive Menschen verspüren oft weit weniger Lust als ihre Partner oder Partnerinnen.
Wie Paare diese Phasen möglichst gut überstehen und welche Sex-Alternativen es gibt, verrät Sexologin Caroline Fux im Interview.
Caroline, viele Menschen mit Depressionen verspüren keine Lust auf Sex. Warum eigentlich?
Caroline Fux: Die Gründe sind vielseitig. Die Depression ist vor allem eine Ressourcenräuberin. Jeden Tag gibt es einen Wettbewerb: Für was kann und will man die vorhandene Energie noch einsetzen? Für Sex reicht es oft schlicht nicht mehr.
Warum nicht?
Gerade in Langzeitbeziehungen passiert Sex nicht einfach so. Er braucht Priorität und Energie und das ist in depressiven Phasen schwierig. Lustlosigkeit kann auch eine Nebenwirkung von Medikamenten sein.
Ist das den Betroffenen bewusst?
Vielen nicht, leider. Sie erleben eine Orgasmus- oder Erektionsstörung und haben keine Ahnung, woher die kommen könnte. Die Aufklärung durch die Behandler funktioniert diesbezüglich oft nicht so gut.
Wieso?
Sexualität ist nicht nur für die Patienten ein Tabuthema, sondern auch für die Behandler. Viele klammern das Thema auch deshalb aus, weil sie es schlicht nicht wichtig finden. Priorität hat, dass die Patienten aus dem Tief kommen. Das mag in der Akutphase Sinn machen, aber auf Dauer ist die Sexualität den wenigsten Leuten egal.
Gewisse Menschen verspüren in einer depressiven Phase aber mehr Lust.
Ja, einige jagen regelrecht den Orgasmen nach, um einen Kick zu erleben. Die Betroffenen fühlen sich so vielleicht kurz lebendig, aber der Genuss bleibt oft auf der
Strecke.
Ist man in einer Beziehung, kommt es zum Ungleichgewicht, da der gesunde Partner ja nach wie vor Lust verspürt.
Da braucht es von den Angehörigen Akzeptanz, aber auch Selbstfürsorge. Braucht man selbst Hilfe? Glaubt man daran, dass es irgendwann besser wird? Kann man vielleicht eigenständig ein sexuelles Projekt beginnen?
Ein sexuelles Projekt?
Keine Angst. Ich verordne hier keine Affären. (lacht) Nehmen wir mal die Selbstbefriedigung. Bei den meisten ist das pure Routine: Man fasst sich immer gleich an und schaut vielleicht denselben Porno. Es ähnelt eher einer Entladung und ist wenig genussvoll. Da kann es sehr spannend sein, mehr in die Selbstbefriedigung zu investieren:
Mal grosszügig Öl oder Gleitmittel verwenden. Sich in der Badewanne statt im Bett zu befriedigen. Durch die Kleider. Es gibt unendlich viel Sexuelles zu entdecken, ohne von jemandem abhängig zu sein.
Die Angst ist aber oft, dass die Sexlosigkeit bleibt.
Diese Angst, dass es für immer schlimm bleibt, ist ja etwas sehr typisches für eine Depression. Diese Krankheit ist wie ein Wintereinbruch im Leben. Man kann im Winter nun mal keine Sonnenblumen pflanzen. Man muss eine sexuelle Überwinterung annehmen.
Wie aber wird es wieder «Frühling»?
In kleinen Schritten zur gegebenen Zeit. Das Paar kann nach körperlicher Intimität abgesehen von Geschlechtsverkehr suchen. Vielleicht eine Massage oder sich nackt in den Armen liegen. Vielen erscheinen solche Dinge trivial, aber sie schaffen Nähe und stimulieren Geist und Körper.
Was, wenn der depressive Partner diese Intimität nicht verträgt?
Dann sollte man nach noch kleineren Gesten suchen. Vielleicht ein Spaziergang Hand in Hand oder sich beim TV schauen umarmen.
…oder sich trotz Unlust auf den Sex einlassen?
Ja, manchmal kommt der Appetit beim Essen. Manchen Paaren hilft es, fixe, wöchentliche Sexdates zu vereinbaren. Für andere endet es aber im Desaster.
Inwiefern?
Diese Technik funktioniert nur, wenn beide den gemeinsamen Sex im Grunde genommen mögen und wollen. Es geht um Gelegenheiten, nicht um Zwang. Man darf immer Stopp sagen, auch mitten im Akt.
«Manchen Paaren hilft es,
Caroline Fux
fixe, wöchentliche Sexdates
zu vereinbaren. Für andere
endet es aber im Desaster.»

📸 Aissa Tripodi
Bricht man mitten im Sex ab, kann das für die andere Person verletzend sein.
Darum muss man diese Option von Anfang an besprechen. Es ist ganz wichtig, dass das Paar über Möglichkeiten und Grenzen ganz konkret spricht.
Der gesunde Partner erfährt in dieser Zeit viel Abweisung. Wie kann man das akzeptieren, ohne gekränkt zu sein?
Man sollte sich solche Gefühle auf keinen Fall verbieten. Zurückweisungen tun weh. Das soll Platz haben und man darf es auch teilen. Aber bitte, ohne es als Druckmittel zu verwenden. In einer Beziehung gibt es kein Recht auf Sex. Und dass eine Person öfters Lust hat als die andere, ist ganz normal. Das haben auch Paare, wenn beide gesund sind.
Aber: Wer Nein sagt, bestimmt. Die gesunde Person hat dann in der Beziehung nicht mehr viel zu melden.
Und das ist ein Problem. Denn auch das gesunde Gegenüber hat relevante Sorgen und Probleme und die dürfen nicht rituell unter den Tisch gekehrt werden. Gewisse Dynamiken lassen sich nicht aufheben, wenn man zusammen unterwegs sein möchte: Bricht sich eine Person während der Wanderung das Bein, dann gehen wir ja auch nicht im selben Schritttempo weiter. Die verletzte oder in diesem Fall die erkrankte Person gibt das Tempo vor.
Die Tempoanpassung zu akzeptieren, ist aber nicht immer einfach.
Ja, die gesunden Partner werden ein Stück weit entmachtet. Sie haben jedes Recht, wütend oder traurig zu sein.
Die gesunden Partner müssen ihre Entmachtung einfach hinnehmen?
Ein Stück weit, ja. Deshalb ist es wichtig, dass es innerhalb oder ausserhalb der Beziehung Inseln gibt, in der die Entfaltung der gesunden Person Priorität hat. Wenn das nicht reicht und wenn sich keine Veränderung einstellt, dann gibt es keine Lösung im eigentlichen Sinne mehr: Dann muss man sich damit arrangieren und sich fragen, ob man die Beziehung so noch weiterführen kann und möchte.
Man beendet die Beziehung wegen zu wenig Sex?
So einfach ist es dann ja selten. Trennungen passieren selten aus einem komplett isolierten Grund heraus. Unabhängig davon wehre ich mich dagegen, dass die Sexualität kein Trennungsgrund sein darf. Das verkennt die Wichtigkeit dieses Lebensbereiches und mit wie viel er verknüpft ist. Wenn jemand neben einem kranken Partner zum Schluss kommt, dass er nicht mehr glücklich sein kann und deshalb gehen will, ist diese Person kein Unmensch.
Die Gesellschaft erwartet, dass der gesunde Partner trotz allem bleibt.
Es geht ja nicht darum, dass man beim ersten Auftauchen von Schwierigkeiten total selbstbezogen einfach flieht. Menschen, die sich von Partnern, die krank sind, trennen, tun das oft in einer Selbstrettung, die krass viel Mut braucht. Oft haben sie einen langen Leidensweg hinter sich und gewaltige Gewissensbisse. Aber es kann nicht sein, dass jemand bedingungslos am Schicksal eines Partners zugrunde geht.
Würde eine Öffnung der Beziehung das Aus verhindern?
Ich rate davon ab. Selbst wenn beide Menschen in der Beziehung psychisch stabil wären, sind offene Beziehungen ein Jonglieren mit 17 Bällen. Zudem würde es die depressive Person möglicherweise noch mehr unter Druck setzen. Und oft ist es ja so, dass der gesunde Partner ja nicht Sex mit irgendjemandem haben will – sondern dass er den Sex mit seinem Partner oder seiner Partnerin vermisst!
Funktioniert eine Beziehung überhaupt ohne Sex?
Klar. Man stirbt nicht, wenn man auf Sex verzichtet. (lacht)
Inwieweit würde eine Paartherapie helfen, um das Sexleben wieder in Schwung zu bringen?
Damit eine Sexualberatung funktionieren kann, müssen die Klienten und ihre Beziehung stabil sein. Das ist mitten in einem depressiven Schub schlicht nicht der Fall. Wenn ein Mensch am Ertrinken ist, bringe ich ihm sicher nicht bei, Cocktails zu mixen.
Und was, wenn die Depression chronisch ist?
Dann ist es vor allem eine Frage der Ressourcen und welche Anliegen und Erwartungen ein Paar hat. Wer sich darauf einlassen kann, dass auch kleine Veränderungen gut tun, kann Stück für Stück wieder sexuellen Genuss in den Alltag bringen.
Zum Schluss: Wie häufig oder wie wenig Sex ist noch gesund?
Zahlen sind total ungeeignet, um die Qualität eines Sexlebens zu bewerten. Entscheidend ist, dass es sich für die Betroffenen gut anfühlt. Das gilt während einer Depression genauso, wie in gesunden Zeiten. Für das eine Paar passt Sex einmal im Monat und die sind happy damit. Andere denken «Jesses! Viel zu wenig» oder «So oft?». Da muss man sich dann halt finden und es ist auch nicht in jeder Phase des Lebens gleich.

Dieser Text erschien im Magazin «Kontext» Nr. 5
Das «Kontext» ist die Fachzeitschrift der Stiftung Pro Mente Sana zu aktuellen Themen der psychischen Gesundheit. Das Magazin erscheint zweimal jährlich.
Für die aktuelle Ausgabe war ich als Gastautor tätig.
Die Mitglieder von «Der Volpe» erhalten das aktuelle «Kontext» kostenlos zugeschickt.
Übrigens: Das Magazin «Kontext» kann für 50 CHF im Jahr via kontakt@promentesana.ch abonniert werden. Oder bestelle hier eine Einzelausgabe.